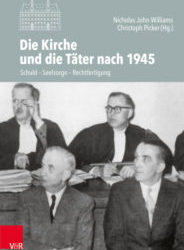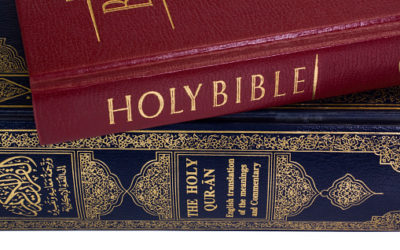Die Evangelische Akademie der Pfalz lädt gemeinsam mit der Evangelischen Akademie im Rheinland sowie der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) zur theologischen Tagung ein.
Veranstaltungsarchiv
Veranstaltungen aus dem Bereich:Tagung
Hätte, hätte, Lieferkette – ein Gesetz zwischen Menschenrechten und Unternehmensrealitäten
Am 1. Januar trat es in Kraft: das Lieferkettengesetz. Es hat zum Ziel, die negativen Auswirkungen unseres Wirtschaftens auf Menschenrechte und Umwelt zu verringern. Weshalb kommt es überhaupt zu Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten? Welche juristischen Werkzeuge hat der Gesetzgeber, um globale Wirtschaftshandlungen zu regulieren? Und wie gehen die Konzerne mit den neuen Bedingungen um?
Wer sind hier „die Guten“? NGOs zwischen Weltverbesserung und Machtausübung
Wie können NGOs mit dem Spannungsfeld von Ökonomisierung und ethischer Zielorientierung umgehen? Mit welchen konkreten Dilemmata sehen sich NGOs in der Praxis konfrontiert? Und welche Ansätze und Strategien gibt es, um der Dynamik und Problematik zunehmender Ökonomisierung entgegenzuwirken?
Der Mensch – nur ein Produktionsfaktor? Personalführung im Spannungsfeld von Ethik und ökonomischer Effizienz
„Hört auf, den Menschen als Produktionsmittel zu betrachten!“, fordert der Personalmanager Dr. Nico Rose. Inwiefern müssen wir die Blickrichtung ändern – von einer Effizienz der Führung hin zu einer Ethik der Führung? Wie kann Führung der Humanverantwortung gerecht werden und die individuelle Arbeits- und Lebensqualität verbessern?
Let`s talk about sex, gender and justice. Braucht es Geschlechterkategorien für Gerechtigkeit?
Gemeinsam mit Expert*innen wollen wir Begriffe wie Sex, Gender und Queer klären, um zu diskutieren, ob die Überwindung (binärer) Geschlechterkategorien Diskriminierungen entgegenwirkt oder befördert.
Was ist Wirtschaft?
In diesem Workshop möchten wir einen Überblick über die wichtigsten Begriffe und Theorien der Wirtschaftswissenschaften, wie Marktwirtschaft, Unternehmensführung oder Marketing, geben, sodass diese verstanden, zusammengefasst und kritisiert werden können.
Wald (er)leben – Nachhaltigkeit spielerisch lernen im Pfälzer Wald
Gemeinsam wollen wir den Pfälzer Wald und das Leben in ihm aktiv erleben und mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir wollen die Folgen unseres Handels diskutieren und kreative Alternativen entwickeln. Wir wollen nicht nur uns, sondern auch etwas bewegen.
Buchpräsentation „Die Kirche und die Täter nach 1945“
Über den Umgang der beiden großen Kirchen mit NS-Täter nach 1945 wird kontrovers diskutiert. Der damalige pfälzische Kirchenpräsident Hans Stempel betreute im Ausland inhaftierte und verurteilte Täter und setzte sich auch politisch für sie ein. An der Evangelischen Akademie der Pfalz wird das Engagement Stempels untersucht und historisch eingeordnet.
Christen und Muslime lesen Bibel und Koran: Barmherzigkeit
Gott ist barmherzig und wir sollen barmherzig sein. Wann berühren uns die Nöte anderer? Was heißt, gnädig miteinander umzugehen? An drei Abenden lesen wir gemeinsam Texte der Bibel und des Koran. Wir fragen danach, was sie heute für uns bedeuten. Und wir versuchen als Christ*innen und Muslim*innen voneinander zu lernen.
Christen und Muslime lesen Bibel und Koran: Gastfreundschaft
Worauf basiert Gastfreundschaft? Was sind ihre Wesenszüge? Welche religiösen Rückbezüge findet sie? Und ist sie das Modell für die Begegnung unter Fremden? An drei Abenden lesen wir gemeinsam Texte der Bibel und des Koran. Wir fragen danach, was sie heute für uns bedeuten. Und wir versuchen als Christ*innen und Muslim*innen voneinander zu lernen.
Christen und Muslime lesen Bibel und Koran: Hoffnung
Die Suche nach dem Guten und die Bemühung um ein moralisch verantwortliches Leben gehören zu den Grundbewegungen, die Christentum und Islam miteinander teilen. An drei Abenden lesen wir gemeinsam Texte der Bibel und des Koran. Wir fragen danach, was sie heute für uns bedeuten. Und wir versuchen als Christ*innen und Muslim*innen voneinander zu lernen.
Was kostet ein Mensch? Die Bewertung, Kategorisierung und Messung menschlichen Lebens nach rational-ökonomischen Entscheidungen
Wir beschäftigen uns mit Fragen der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens. Expert*innen geben uns Einblicke, wie ein Leben berechnet wird und wann diese Berechnungen Anwendung finden (dürfen). Gemeinsam diskutieren wir, ob eine rational-ökonomische Berechnung sinnvoll erscheint, und eruieren alternative Determinanten.